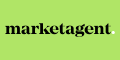|
Das Projekt Rekonstruktion eines germanischen Gehöftes in Elsarn ist Teil des Gesamtkonzeptes des Kulturparks Kamptal, der von sechzehn Gemeinden - von
Langenlois bis Horn -, der Krahuletz-Gesellschaft Eggenburg, dem Stift Altenburg und dem Schloss Greillenstein gemeinsam getragen wird. In der Ortschaft Elsarn der Gemeinde Straß im
Straßertale wurde in diesem Rahmen ein germanisches Gehöft der römischen Kaiserzeit als Freilichtmuseum geplant.
Die Gebäude wurden in mehreren Baukampagnen von Studenten des Institutes für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien unter Mithilfe der Einwohner von Elsarn in den Jahren 1996 bis
2001 errichtet. Die Schaugärten mit alten Kulturpflanzen wurden von der Arbeitsgruppe Archäobotanik des Instituts für Botanik der Universität für Bodenkultur Wien konzipiert und
angelegt. Ein Naturlehrpfad im bewaldeten Bereich zeigt, welche wildwachsenden Baum- und Straucharten für den Hausbau und das Handwerk genutzt wurden.
Das Freilichtmuseum soll Einblicke in das Alltagsleben der bäuerlichen Bevölkerung des 2. und 3. Jahrhunderts nach Christus im Gebiet nördlich der mittleren Donau geben. Im
Vordergrund stehen dabei die Architektur der Gebäude, das Haushandwerk und die ökonomischen sowie ökologischen Grundlagen der Menschen der Vergangenheit. Die Rekonstruktion des
germanischen Bauernhofes beruht auf archäologischen Befunden der römischen Kaiserzeit aus dem nördlichen Mitteldonaugebiet. Beim Bau der Objekte wurden vor allem Baumaterialien und
Werkzeugtypen verwendet, für die es an frühgeschichtlichen Fundplätzen archäologische Nachweise gibt. Die Errichtung der Anlage bot auch die Möglichkeit für experimentalarchäologische
Versuche zur Technologie der Holzbearbeitung und Landwirtschaft dieser Zeit.
In Elsarn soll mit dieser Freilichtanlage ein Ausflugsziel geschaffen werden, das für Gäste und Einheimische in gleicher Weise eine Bereicherung des Freizeit- und Bildungsangebotes
für die ganze Familie mit sich bringt.
Projektierung: Marktgemeinde Straß im Straßertale in Zusammenarbeit mit dem Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien, der Arbeitsgruppe Archäobotanik des Instituts für
Botanik der Universität für Bodenkultur und dem Kulturpark Kamptal
Die Germanen im Kamptal. Wer waren sie, wann und woher kamen sie?
Unter dem Sammelbegriff „Germanen" werden in der römischen Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit (1.-5. Jahrhundert nach Christus) verschiedene Völker und Stämme in Mitteleuropa und im
südlichen Skandinavien gefasst.
Der römische Historiker Tacitus schrieb um 100 nach Christus seine „Germania'', die heute eine der wichtigsten historischen und ethnographischen Quellen über die Germanen darstellt.
Er berichtete, dass ursprünglich eine Gruppe kleinerer Stämme im heutigen Belgien „Germanen" geheißen hätten (Germani cisrhenani). Dieser Name sei sodann von den Galliern und Römern
auf sämtliche Stämme übertragen worden, die die Germania Magna besiedelten, einem Gebiet, das sich von der nördlichen Reichsgrenze des römischen Imperiums jenseits des Rheins und der
Donau bis hin zur Weichsel erstreckte. Es gibt jedoch keine antike Schriftstelle, die besagt, dass die Germanen sich selbst auch Germani nannten.
"Östlich der Hermunduren sitzen die Narister und darauf folgen die Markomannen und die Quaden. Sie bilden die Stirnseite Germaniens nach Süden an der Donau..." so Tacitus im Jahre 98
n. Chr.
Durch innergermanische Auseinandersetzungen und Völkerbewegungen um Christi Geburt ließen sich im Laufe des l. Jahrhundert nach Christus markomannisch-quadischen Gruppen in Mähren, in
der Slowakei und im nördlichen Niederösterreich nieder. Bis ins 5. Jahrhundert nach Christus gehörte das norddanubische Niederösterreich zum Siedlungsgebiet der Markomannen und
Quaden. Charakteristisch für diese Zeit waren intensive wirtschaftliche und kulturelle Kontakte zum römischen Reich, die die Lebensweise und die gesellschaftliche Entwicklung beider
Stämme erheblich beeinflussten. Unterbrochen wurden diese Beziehungen durch die Markomannenkriege von 166 bis 180 nach Christus. Durch gezielte Feldzüge über die Donau, die der
römische Kaiser Marc Aurel selbst anführte, versuchte Rom die Grenze an der mittleren Donau wiederherzustellen.
Siedlungs- und Grabfunde aus Etsdorf, Feuersbrunn, Grafenwörth, Hohenwarth, Kammern, Landersdorf, Langenlois, Ronthal, Schiltern, Seebarn, Straß im Straßertal, Zeiselberg und Zemling
belegen eine intensive germanische Siedlungstätigkeit vom 1. bis ins 5. Jahrhundert nach Christus in der Umgebung von Elsarn. Rechteckige Grabenanlagen von römischen
Befestigungsbauten in Fels am Wagram und Plank am Kamp belegen die wichtige strategische Bedeutung des Gebietes für die Römer.
Siedlungswesen und Hausbau
 Nördlich der
mittleren Donau befanden sich neben geschlossenen Dorf- und Weilersiedlungen vor allem Einzelgehöfte, die von der bäuerlichen Lebensweise geprägt waren. Als Siedlungsplätze wurden
Erhebungen oder Terrassen entlang von Flusslandschaften (z.B. Zwingendorf, Seebarn), Randgebiete von Beckenlandschaften, höher liegende Geländesporne (Heidenstatt-Limberg) und
Höhenlagen (Burgstall-Schiltern, Oberleiserberg bei Ernstbrunn) bevorzugt. Nördlich der
mittleren Donau befanden sich neben geschlossenen Dorf- und Weilersiedlungen vor allem Einzelgehöfte, die von der bäuerlichen Lebensweise geprägt waren. Als Siedlungsplätze wurden
Erhebungen oder Terrassen entlang von Flusslandschaften (z.B. Zwingendorf, Seebarn), Randgebiete von Beckenlandschaften, höher liegende Geländesporne (Heidenstatt-Limberg) und
Höhenlagen (Burgstall-Schiltern, Oberleiserberg bei Ernstbrunn) bevorzugt.
Ein Bauernhof bestand zumeist aus einem Wohngebäude, mehreren Grubenhäusern und einem Pfostenspeicher sowie Nebeneinrichtungen. Die Größe eines Einzelgehöftes wurde in Bernhardsthal
mit zwei Hektar errechnet. Das Zentrum bildete das Wohngebäude, in dem ein Wohn-, ein Wirtschafts- und ein Stallbereich untergebracht sein konnten. Der Befund für das rekonstruierte
Wohnhaus in Elsarn stammt aus der germanischen Siedlung in Bernhardsthal. Das Gebäude war etwa 10,7 m lang sowie rund 5,8 m breit. Die Längswände des Originalbefundes bestanden aus je
zehn bis zu 35 cm tief im Boden erhaltenen Pfostenlöchern. Im Inneren fanden sich drei Pfostenstellungen, an den beiden Schmalseiten jeweils drei Doppelpfostenstellungen.
Zu den charakteristischen Nebengebäuden zählten im norddanubischen Niederösterreich sechspfostige Grubenhäuser, deren Bodenniveau bis zu einem Meter eingetieft sein konnte. Die
Baugruben waren 10 bis 16 qm groß, meist West-Ost orientiert und von rechteckigem Grundriss. An der südlichen Längsseite befand sich meist der abgetreppte Eingang. Die Wände wurden
aus Flechtwerk mit oder ohne Lehmbewurf gebildet, es gibt jedoch auch Nachweise für Ständerbohlen- oder Blockbautechnik. Herdstellen konnten selten nachgewiesen werden. In diesen
Bauten fanden sich immer wieder Hinweise auf bäuerliches Handwerk wie z.B. Textil- und Beinverarbeitung, aber auch Erntevorräte. Die Grubenhäuser in Elsarn wurden nach Vorlagen aus
Vyskov in Mähren und aus Hanftal bei Laa an der Thaya rekonstruiert. Weitere Einrichtungen waren wohl überdachte Werkplätze für Keramikherstellung und Eisenverarbeitung sowie
Kalkbrennerei und Brotbacköfen. Für die Aufbewahrung der Vorräte legte man Speichergruben, gestelzte Pfostenspeicher sowie Stroh- und Heulagerplätze an.
Nahrungsproduktion
 Ackerbau und Viehzucht lieferten die Lebensgrundlagen für die germanischen Siedler. Die annähernd quadratischen oder trapezförmigen Felder waren von sehr breiten und leicht
gewölbten Rainen eingefasst. Sie lagen meist in der Nähe des Hofes. Mit den damals üblichen Hakenpflügen wurden die Felder kreuzweise gepflügt, die breiten Raine ermöglichten dem
Pfluggespann das häufige Wenden. In manchen Gegenden waren Feldfluren durch Zäune gegen eindringendes Vieh geschützt. Kleine umzäunte Flächen dürften als Gärten genutzt worden
sein. Ackerbau und Viehzucht lieferten die Lebensgrundlagen für die germanischen Siedler. Die annähernd quadratischen oder trapezförmigen Felder waren von sehr breiten und leicht
gewölbten Rainen eingefasst. Sie lagen meist in der Nähe des Hofes. Mit den damals üblichen Hakenpflügen wurden die Felder kreuzweise gepflügt, die breiten Raine ermöglichten dem
Pfluggespann das häufige Wenden. In manchen Gegenden waren Feldfluren durch Zäune gegen eindringendes Vieh geschützt. Kleine umzäunte Flächen dürften als Gärten genutzt worden
sein.
Die Ackerflächen konnten nicht jährlich bebaut werden. Zur Regeneration der Bodenfruchtbarkeit mussten Brachephasen eingelegt werden. Stoppelfelder und brachliegende Äcker wurden
wahrscheinlich beweidet, um dem Boden Nährstoffe zuzuführen. Auch eine "echte" Düngung der Felder mit Stallmist und Haushaltsabfällen war üblich. Wo es die Bodenverhältnisse
erforderten, wurden die Äcker mit Kalk oder Humus angereichert ("Plaggenwirtschaft"). Auf den fruchtbaren Lößböden des Weinviertels dürften die Einhaltung von Brachephasen, die
Düngung mit Stallmist und auch der alternierende Anbau von stickstoffbindenden Hülsenfrüchten (Erbse, Linse, Saubohne) ausreichend gewesen sein. Wahrscheinlich hat man sich auch die
Vorteile einer Kombination von Sommer- und Wintergetreideanbau zunutze gemacht, um einen besseren Schutz gegen witterungsbedingte Ernteausfälle und um höhere Erträge sowie eine
gleichmäßigere Verteilung des Arbeitsaufwandes über das landwirtschaftliche Jahr zu erzielen.
Die Felder scheinen von der Aussaat bis zur Ernte sorgfältig gepflegt worden zu sein (z.B. händisches Ausjäten der Unkräuter). Bei der Getreideernte wurden die Halme - wohl auch zur
Strohgewinnung - in Bodennähe geschnitten. Als Erntegeräte kamen Sicheln und Sensen, bei der Weiterverarbeitung Dreschflegel und Wurfschaufel zum Einsatz. Das Erntegut wurde in
Pfostenspeichern und Vorratsgruben sowie im Wohntrakt oder Dachboden des Haupthauses aufbewahrt.
Honigproduktion
 Als Süßstoff und zur Herstellung alkoholischer Getränke (Met) war Honig ein
äußerst begehrtes Lebensmittel. Archäologisch nachgewiesen sind Bienenkörbe aus Stroh und Weidenruten, aber auch ausgehöhlte Stammstücke ("Klotzstülper"), die den Übergang von der
Waldbienenwirtschaft zur Hausbienenhaltung kennzeichnen. Als Süßstoff und zur Herstellung alkoholischer Getränke (Met) war Honig ein
äußerst begehrtes Lebensmittel. Archäologisch nachgewiesen sind Bienenkörbe aus Stroh und Weidenruten, aber auch ausgehöhlte Stammstücke ("Klotzstülper"), die den Übergang von der
Waldbienenwirtschaft zur Hausbienenhaltung kennzeichnen.
Jagd und Fischfang
Die Jagd dürfte insgesamt nur wenig zur Ernährung beigetragen haben. Sie war aber als Quelle von Rohstoffen von Bedeutung (Geweih, Knochen, Felle und Sehnen). Eine vielseitige Nutzung
dürften Wildarten wie Auerochse, Wisent, Elch, Rothirsch, Bär, Reh und Dachs ermöglicht haben, während Luchs, Wolf, Biber, Rotfuchs, Wildkatze sowie diverse Marderarten wohl vor allem
wegen ihres Pelzes gejagt wurden. Die Bedeutung der Fischerei ist mangels Untersuchungen nur unzureichend bekannt.
Kultur- und Sammelpflanzen
 Die Auswahl der
angebauten Kulturpflanzen richtete sich nach den Grundbedürfnissen der menschlichen Ernährung. Als ergiebige Energie- und Kohlenhydratquelle dienten mehrere Getreidearten. Da Fleisch
und Milch nicht ständig zur Verfügung standen, wurde vor allem auf pflanzliche Eiweißquellen (Hülsenfrüchte) zurückgegriffen. Lebenswichtige Fettsäuren wurden von Ölpflanzen
geliefert. Die Auswahl der
angebauten Kulturpflanzen richtete sich nach den Grundbedürfnissen der menschlichen Ernährung. Als ergiebige Energie- und Kohlenhydratquelle dienten mehrere Getreidearten. Da Fleisch
und Milch nicht ständig zur Verfügung standen, wurde vor allem auf pflanzliche Eiweißquellen (Hülsenfrüchte) zurückgegriffen. Lebenswichtige Fettsäuren wurden von Ölpflanzen
geliefert.
Verschiedene Gemüsearten, Obst, Nüsse und Beeren ergänzten den pflanzlichen Speisezettel und steuerten wertvolle Vitamine, Ballast- und Mineralstoffe bei. Wie sehr der
fortschrittliche Gartenbau der Römer die germanische Landwirtschaft beeinflusst hat, ist noch umstritten. Gerade in grenznahen Gebieten (Donau-Limes) ist eine frühzeitige
Einflussnahme vorstellbar, wegen des unzureichenden Forschungsstandes und der geringen Erhaltungswahrscheinlichkeit von Gemüse- und Gewürzpflanzen aber noch kaum nachgewiesen. Auch
beim Obst fehlen bisher eindeutige Kulturnachweise.
Aus germanischen Siedlungen sind zahlreiche Getreidearten belegt, besonders Gerste, Emmer, Einkorn, Rispenhirse, Hafer und Roggen. Aus dem Weinviertel gibt es auch Dinkel- und
Nacktweizenfunde. Das Hülsenfruchtspektrum umfasste Erbse, Linse, Saubohne und Linsen-Wicke, an Ölfrüchten sind Lein und Leindotter nachgewiesen. Als Gemüse- und Salatpflanzen dienten
verschiedene Melden-, Kohl- und Gänsefußarten, außerdem Sellerie, Löwenzahn, Brennnessel und Karotte. Ob es sich bei den einzelnen Pflanzen um Kultur- oder Wildformen handelte, ist
nicht gesichert. Sammelpflanzen waren Brombeeren, Haselnüsse, Himbeeren, Holunder und Erdbeeren. Als Bierwürze dürfte auch Hopfen und als Heilpflanzen z. B. Eibisch und Bilsenkraut
gesammelt worden sein. Gezielt angebaut hatte man hingegen Färbepflanzen wie z. B. den Waid, der zum Blaufarben von Textilien diente.
Haustiere
Der Haustierbestand der Germanen umfasste Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Pferd, Huhn, Gans, Hund und Katze. Das Rind war der wichtigste Fleisch- und Milchlieferant, gefolgt von Schaf
und Ziege, die vor allem in der Nord- und Ostseeküstenregion stark vertreten waren. Schafe lieferten außerdem wertvolle Wolle zur Textilerzeugung. In weiten Teilen Germaniens wurden
auch Schweine zur Fleisch- und Fetterzeugung gehalten. Rinder und Pferde wurden als Arbeitstiere eingesetzt. Hauptsächlich diente das Pferd aber als Reittier. Nach den römischen
Schriftstellern Caesar und Tacitus waren die germanischen Pferde weder schön noch übermäßig schnell, sie zeichneten sich aber durch Ausdauer, Widerstandsfähigkeit und
Futtergenügsamkeit aus. Die Germanen hielten auch mittelgroße und große Hunde, die als Hof-, Hirten- und Jagdhunde eingesetzt wurden, sowie bereits auch Katzen. Im 3. und 4.
Jahrhundert nach Christus wurden schließlich die größeren römischen Rinder, darunter auch Ochsen, und die Zwerghunde aus den römischen Provinzen eingeführt. Für die Versorgung der
Haustiere spielte neben der Waldweide und der Nutzung von Laub als Futtermittel (Schneitelwirtschaft) bereits das Grünland für die Heugewinnung eine wesentliche Rolle. Dadurch konnten
größere Mengen von Vieh über den Winter gebracht werden.
Handwerk
 Das Handwerk
spielte im bäuerlichen Leben eine wichtige Rolle, da die meisten Gerätschaften und Einrichtungsgegenstände am Hof hergestellt wurden. Die Arbeiten erfolgten einerseits im Wohngebäude
und in den Grubenhäusern, andererseits auf überdachten Werkplätzen oder im Freien. Das Handwerk
spielte im bäuerlichen Leben eine wichtige Rolle, da die meisten Gerätschaften und Einrichtungsgegenstände am Hof hergestellt wurden. Die Arbeiten erfolgten einerseits im Wohngebäude
und in den Grubenhäusern, andererseits auf überdachten Werkplätzen oder im Freien.
Die handwerklichen Tätigkeiten umfassten das Mahlen von Getreide, das Backen von Brot, das Spinnen und Weben von Wolle, die Verarbeitung von Flachs, das Flechten von Matten und Körben
sowie die Verarbeitung von Rohmaterialien wie Holz, Knochen und Geweih und Rohhaut. Auf manchen Gehöften wurden auch Eisen und Buntmetalle verarbeitet.
Um Leder und Felle herzustellen, wurden die Häute von geschlachteten Tieren entfleischt, getrocknet und eingesalzen. Je nach Verwendungszweck wurden unterschiedliche Gerbverfahren wie
Fett- und Hirngerbung oder Gerbung mit pflanzlichen Zusätzen wie z.B. die Lohgerbung mit Eichen- oder Fichtenrinde angewandt. Leder und Felle wurden zu Schuhen, Mützen, Gürteln,
Zaumzeugen und zu vielen anderen Gebrauchsgegenständen weiterverarbeitet.
Aus Geweih und Knochen wurden Messergriffe, Kämme, Pfrieme, Ahlen, Nadeln, Knöpfe und Spielwürfel geformt. Holz wurde zu Webschwertern, Schäftungen, Spaten, Schaufeln, Eggen, Wagen
und Pflügen verarbeitet. Aus Holzdauben wurden Eimer, Wannen und Fässer hergestellt. Auf der Drehbank erzeugte man Möbelteile, Radnaben, Griffe und Gefäße.
 Für die
einzelnen Gerätschaften wurden je nach Eignung unterschiedliche Holzarten ausgewählt. Für die
einzelnen Gerätschaften wurden je nach Eignung unterschiedliche Holzarten ausgewählt.
Aus der Produktion des Schmiedes stammten Messer, Nägel, Schlüssel, Ketten, Sicheln, Sensen und Pflugscharen.
Geräte und Schmuck aus Buntmetall wurden in speziellen Formen aus Ton oder Sandstein gegossen. Viele der Schmuckstücke wurden mit Ornamenten in Filigran-, Granulations- und
Tauschiertechnik versehen. Nicht selten waren auch aufgelötete Silberbleche. Im 4. und 5. Jahrhundert nach Christus kam durch die Kontakte mit dem römischen Reich die
Feuervergoldung hinzu.
Die Keramik für den täglichen Gebrauch, Webgewichte und Spinnwirtel wurden wahrscheinlich direkt bei den Gehöften im offenen Feuer oder in Brennöfen gebrannt. Vom l. bis zum 3.
Jahrhundert nach Christus wurden die Gefäße handgefertigt, erst im 4. Jahrhundert begannen die Germanen die Keramik auf der Drehscheibe herzustellen. Charakteristisch ist die
Schwarzfärbung und die Vielfalt an Verzierungsmotiven wie z.B. der Warzendekor vor allem bei den handgeformten Gefäßen.
Hand- und Drehmühlen aus Felsgestein, Granit oder Basaltlava wurden vor Ort hergestellt oder als Fertigprodukte importiert.
Oft reichten die handwerklichen Betätigungen weit über den Eigenbedarf hinaus. Der Zimmermann, der Drechsler und der Tischler sowie der Wagenbauer und der Böttcher dürften wie der
Schmied, der Bronzegießer und der Töpfer mehrere Gehöfte in der Umgebung versorgt haben.
Hausrat
 In den germanischen Siedlungen des nördlichen Mitteldonaugebietes konnten zahlreiche Hausratsgegenstände nachgewiesen werden. Dazu gehören Gefäße aus Ton,
Messer, Schlüssel, Äxte und Werkzeuge aus Eisen, Metall- und Glasgefäße, Webgewichte und Spinnwirtel sowie Mahl-, Schleif- und Wetzsteine. Nicht erhalten haben sich Möbel, Geräte oder
Gefäße aus Holz. Seltener wurden Trachtgegenstände, Schmuck oder Waffen gefunden. Diese stellten charakteristische Grabbeigaben dar. In den germanischen Siedlungen des nördlichen Mitteldonaugebietes konnten zahlreiche Hausratsgegenstände nachgewiesen werden. Dazu gehören Gefäße aus Ton,
Messer, Schlüssel, Äxte und Werkzeuge aus Eisen, Metall- und Glasgefäße, Webgewichte und Spinnwirtel sowie Mahl-, Schleif- und Wetzsteine. Nicht erhalten haben sich Möbel, Geräte oder
Gefäße aus Holz. Seltener wurden Trachtgegenstände, Schmuck oder Waffen gefunden. Diese stellten charakteristische Grabbeigaben dar.
Besonders wichtig ist die Keramik, da sie zum Zubereiten und Kochen von Speisen, zum Trinken und Aufbewahren von Vorräten gedient hat. Neben handgeformten Gefäßen aus der
Eigenproduktion fanden sich auch über den Handel erworbene scheibengedrehte Gefäße aus den römischen Provinzen.
Vor allem in grenznahen Gebieten bestand zwischen den primär auf Selbstversorgung ausgerichteten Gehöften und den römischen Provinzen eine rege Handelstätigkeit. Antike Schriftsteller
berichten, dass die Römer Gänsedaunen, Seife - sehr begehrt war die Seife von den Batavern -, blondes Frauenhaar für Perücken, Bernstein zur Schmuckerzeugung sowie Felle und Häute aus
Germanien importierten. Im Gegenzug kauften Germanen auf römischen Märkten feines Tafel- und Gebrauchsgeschirr, Metall- und Glasgefäße, Trachtzubehör wie Gürtel, Fibeln und Schmuck.
Besonders begehrt war die Terra Sigillata, ein rotfarbenes Luxusgeschirr. Gleichzeitig wurden auch römische Tisch- und Speisesitten übernommen. Die Marktplätze lagen zumeist im Umfeld
der römischen Grenze, die römischen Händler dürften neben der lateinischen Sprache auch germanische Dialekte beherrscht haben.
Tracht
Die Kleidungs-, Haar- und Barttracht der Germanen ist uns von Moorleichen aus Norddeutschland und Dänemark sowie vornehmlich durch Berichte römischer Autoren und von römischen
Staatsdenkmälern, wie z.B. von der Marcus Aurelius Säule in Rom, und von den römischen Grabsteinen bekannt.
Die Frauen trugen lange ärmellose Kleider, die an den Schultern durch Fibeln zusammengehalten und um die Hüften gegurtet waren. Darunter wurden Ärmeljacken getragen. Umhänge, die an
der Schulter mit einer Fibel zusammengeheftet waren, ergänzten das Gewand. Das Haar wurde von einem Netz oder Kopftuch zusammengehalten und mit einer Nadel festgesteckt.
Die Männer waren mit langen Hosen oder mit Kniehosen bekleidet, die durch Leder- und Wollgürtel gehalten wurden. Als Oberbekleidung dienten hemdartige Kittel, darüber zuweilen
viereckige Umhänge, die an der rechten Schulter von einer Fibel gehalten wurden. Das Haupthaar und den Bart pflegte man mit Rasiermessern und Kämmen. Vor allem bei den Elbgermanen
wurde das Haar von der linken Seite her gekämmt und über der rechten Schläfe zusammengeknotet (sogenannter Suebenknoten).
Die Waden wurden bis zum Knie durch Wadenbinden geschützt. An den Füßen trugen Männer und Frauen Bundschuhe aus Leder.
Religion und Totenkult
Über die religiösen Vorstellungen der germanischen Stämme ist sehr wenig bekannt. Überlieferungen von antiken Schriftstellern, archäologische Befunde aus Siedlungen, Gräberfelder und
Hortfunde spiegeln dieses Thema nur ansatzweise wider. Häufig sind Plätze überliefert, an denen Objekte, Tiere und auch Menschen aus religiösen Gründen geopfert wurden. Diese sind vor
allem im südlichen Skandinavien und nördlichen Mitteleuropa bekannt. Sie wurden meist von mehreren Siedlungen oder Stämmen als Heiligtümer genutzt. Einer der bekanntesten Plätze im
nördlichen Mitteleuropa ist z.B. der Mooropferplatz von Oberdorla in Thüringen, der vom 6. Jahrhundert vor Christus bis ins 10./11. Jahrhundert nach Christus benutzt wurde. Dort
wurden im See und entlang des Ufers zahlreiche Opferstellen entdeckt, die durch Stocksetzungen oder Flechtwerkzäune eingegrenzt waren. Neben anthropomorphen Holzfiguren
unterschiedlicher Form wurden die Reste von 334 Tieren und 40 Menschen gefunden. Außerdem hat man Tongefäße, Kult- und Arbeitsgeräte, Radteile, Fischreusen, Flachsbündel, Steine und
Zimmermannswerkzeug ausgegraben.
Ganze Heeresausrüstungen wurden auf den Mooropferplätzen im südskandinavischen Raum wie Thorsberg, Vimose, Ejsbpl und Illerup niedergelegt.
Auch in den ländlichen Siedlungen gab es Einrichtungen, von denen man annehmen darf, dass sie gemeinschaftlich religiös genutzt wurden, wie die Versammlungshalle auf der Feddersen
Wierde in Norddeutschland.
Einen religiösen Hintergrund dürften auch die Bestattungen von Säuglingsskeletten unter den Hausherden, in den Ställen oder Brunnen der kaiserzeitlichen Siedlungen des
Nordsee-Küstengebietes haben. Oft wurden als Bauopfer auch Haustiere in der Nähe des Herdes, der Hauswände oder unter den Türschwellen deponiert.
Mit einer Niederlegung im Moor dürfte auch das reiche Zaumzeug von Mödring im nordöstlichen Waldviertel in Verbindung stehen. Auch manche Gefäßformen könnten im kultischen
Zusammenhang benutzt worden sein.
Bestattungssitten
Die Toten wurden in der Regel in der Nähe der Siedlung - oft in Sichtweite - bestattet. In den ersten beiden Jahrhunderten nach Christus dominierte die Brandbestattung gegenüber der
Körperbestattung. Die Toten wurden auf Scheiterhaufen verbrannt, das Knochenklein in tönernen Urnen, Holzbehältern, Beuteln oder Metallgefäßen beigesetzt. Trachtbestandteile
und Grabbeigaben wie Schmuckstücke, Waffen oder Keramik wurden mitverbrannt oder erst nachträglich ins Grab beigegeben. Oft hat man diese Gegenstände absichtlich unbrauchbar
gemacht.
Grabsteine mit germanischen Namensnennungen in den römischen Provinzen weisen auf Bestattungen von Germanen hin, die von den Römern umgesiedelt oder als Sklaven erworben wurden.
Vereinzelt finden sich auch in der älteren römischen Kaiserzeit Körpergräber, die meist überdurchschnittlich reich ausgestattet waren und mit der sozial höher stehenden
Bevölkerungsschicht verbunden werden können.
Ab dem 3. Jahrhundert nach Christus setzte sich bei den Germanen die Körperbestattung vermehrt durch, wobei Leichenbehältnisse aus Holz u. ä. kaum nachgewiesen sind. Den Toten wurde
außer Nahrung in Form von Fleisch, Brei, oder Getränken ihr persönliches Eigentum wie Fibeln, Gürtel mit Metallbeschlägen, Messer, Scheren, Spindeln, Toilettebestände, aber auch
Waffen oder Holzkästchen mit Schlüsseln mitgegeben.
Gesellschaftsstruktur
Die kleinste Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft war die Familie. Neben Eltern und Kindern lebten auch unverheiratete Geschwister und Großeltern am Hof. Zur Hausgemeinschaft gehörte
auch das Gesinde, im wesentlichen Unfreie, die wahrscheinlich nicht nur im Hauptgebäude sondern auch in Nebengebäuden untergebracht waren. Die Zahl der auf einem Hof lebenden Personen
war von seiner Größe abhängig, man darf an 8 bis 15 Personen denken.
Den Mittelpunkt eines Hauses bildete die Feuerstelle. Vergrößerte sich ein Gehöft bzw. nahmen die Feuerstellen innerhalb eines Hauses zu, sind mehrere Kleinfamilien unter einem Dach
anzunehmen, die von Fall zu Fall auch eigene Betriebe auf demselben Hofgelände gegründet haben konnten. Die fortschreitende generationenmäßige Teilung eines
Familienverbandes und der Besitzanteile konnte zur Bildung einer Großfamilie oder Sippe führen, die mehrere Haushalte umfassen konnte. Zur Großfamilie gehörten Unfreie und Sklaven,
kriegsgefangene Römer und Angehörige fremder Stämme.
Der Reichtum eines Gehöftes und seiner Bewohner beruhte auf der Anzahl der Haustiere und der Größe der Acker- und Weideflur. Eine soziale Differenzierung lässt sich nachweisen, wenn
sich ein Gehöft durch Lage und Form von den übrigen abhob. In Feddersen Wierde bildete sich am Rande des Dorfes ein „Herrenhof' heraus, der durch Viehreichtum, Handel und Handwerk
nach und nach eine führende Position erlangte.
Für die Organisation von Neuland und dessen Aufteilung sowie für die Götterverehrung im Jahreskreislauf dürfte es überregionale Verbände gegeben haben. Die einzelnen Familien,
Großfamilien fühlten sich einem Stamm zugehörig, der mehrere Talschaften umfassen konnte. Zur inneren Struktur eines Stammes gehörte die Volksversammlung, die aus allen freien Männern
bestand. Sie stimmten über die Stammesangelegenheiten ab bzw. wählten aus den führenden Familien die Priester und die Stammesführer, die auch die Verhandlungen mit dem römischen
Kaiser oder mit den römischen Gesandten führten. Meist gehörten mehrere Stämme zu größeren Stammesverbänden, die durch die gemeinsame Abkunft von einem Gott kultisch (z.B.
Nerthus-Kult), durch politischen Anschluss oder durch militärische Unterwerfung entstanden sein konnten.
Die Runen
Das Leben der Germanen ist eigentlich nur durch Texte römischer Schriftsteller und durch das archäologische Fundgut bekannt. Die Germanen entwickelten zwar eine eigene Schrift - die
Runen -, diese wurden aber nur für kurze Inschriften mit magischem oder religiösem Inhalt oder mit Personennamen verwendet, die auf Lanzenspitzen, Schildbuckeln und Schwertortbändern
sowie auf Trachtbestandteilen eingeritzt waren. Zentrum der Runenschöpfung war wohl Skandinavien, wo auch die ältesten Runeninschriften gefunden wurden und an das Ende des 2.
Jahrhundert nach Christus gehören. Im Mitteleuropa setzten sie erst vereinzelt im 4. und 5. Jahrhundert ein, die Masse der südgermanischen Inschriften stammt aus dem 6. und 7.
Jahrhundert nach Christus.
Experimentelle Archäologie
 Bereits in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts stellten Forscher praktische
Experimente an, um so Aussagen über die technischen Möglichkeiten von vergangenen Kulturen untermauern zu können. Bereits in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts stellten Forscher praktische
Experimente an, um so Aussagen über die technischen Möglichkeiten von vergangenen Kulturen untermauern zu können.
In unseren Tagen beziehen sich die Fragen der Archäologen vor allem auf die Alltagskultur der Menschen, ihre Aktivitäten, Siedlungsgewohnheiten und Überlebensstrategien. Bei der
Beantwortung dieser Fragen stützt sich die moderne Forschung zunehmend auf die Ergebnisse der Experimentellen Archäologie, um Erklärungen und Interpretationen von Grabungsbefunden zu
überprüfen.
Archäologische Experimente werden vor allem zu den Bereichen Hausbau (Baumaterialien, Konstruktion), Landwirtschaft (Bodenbearbeitung, Anbau, Lagerung), Technologie (Gewinnung von
Rohstoffen wie Metallen, Teer, Glas) und Handwerk (Holz- und Beinverarbeitung, Metallurgie, Glas- und Keramikherstellung, Textil- und Lederbereich) angesetzt. Aber es gibt auch
Versuche zum Transportwesen, zur Trageweise von Kleidungsstücken oder zum Anlegen von Grabhügeln usw. Dabei wird versucht, Arbeitsergebnisse unter gleichen oder zumindest sehr
ähnlichen Bedingungen wie in der Vorzeit zu erreichen.
Am Beginn eines archäologischen Experiments steht eine Forschungsfrage. Die Experimentelle Archäologie verwendet naturwissenschaftliche Dokumentationstechniken. Wenn die Ergebnisse
der Versuche letztlich auch keinen Beweischarakter haben, geben sie uns doch eine gute Vorstellung vom Alltagsleben der Vergangenheit, mit der wir uns wohl bei vielen Fragen
weitgehend an die historische Realität annähern können. Mittelpunkt der Experimentellen Archäologie bleibt immer der Mensch mit seinen Fähigkeiten, seinen Problemen und mit seinen
Lösungsstrategien.
Rekonstruktionen von Gebäuden
Jede Gebäuderekonstruktion sollte sich auf einen konkreten archäologischen Befund beziehen.
Hausmodelle in Originalgröße haben gegenüber rein graphischen oder stark verkleinerten Modellen den Vorteil, dass sich bei ihrem Bau unbrauchbare Konstruktionen empirisch selber
ausschließen. Eine intensive Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Stand der Bau- und Siedlungsforschung, der Wirtschaftsweise der entsprechenden Zeit und den handwerklichen
Möglichkeiten der Menschen durch intensives Studium der auf uns gekommenen Werkzeuge und Befunde, sowie der Baumaterialien ist heute Voraussetzung für einen wissenschaftlich
vertretbaren Wiederaufbau. Der Beweis, dass eine für gut befundene Konstruktionsvariante auch in der Vorzeit genau so erbaut worden ist, kann nicht erbracht werden. Rekonstrukteure
müssen sich damit bescheiden, denkbare Konstruktionsvarianten aufzuzeigen, die sich auch in der Praxis umsetzen lassen.
|

 Die Lachner´s
Die Lachner´s